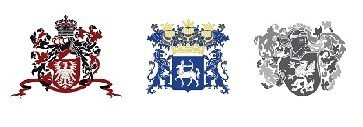Keine Artikel
Preise verstehen sich inklusive MwSt.
Kategorien
Herrschaftsinstrumente
Wir sagten, dass die Spannungen zwischen zentraler und partikularer Herrschaftstendenz zu den Konstanten der europäischen Staatenentwicklung im Mittelalter gehört. Sie ist die einzige Konstante nicht. Daneben stehen die Dauerkonflikte zwischen Wahl- und Erbmonarchie, zwischen weltlicher und kirchlicher Herrschaft, und es gibt den Wettbewerb um die europäische Hegemonie. Die schafft sich ihre geschichtsphilosophische Begründung mit der möglichen oder erstrebten Wiederherstellung jenes Reiches, das einst Karl der Große regierte und dessen Ausdruck der aus der römischen Antike bezogene Kaisertitel war.
Auch der Begriff renovatio imperii Romanorum, der dafür stand, spielte gleichermaßen auf das untergegangene römische Weltreich wie auf das Imperium des Karolingers an. Nun waren die beiden Gebiete nicht deckungsgleich, ein Großteil des römischen Territorialbesitzes war zudem die Domäne von Byzanz, von dem sich Westrom in immer stärkerem Maße abhob, religiös wie säkular; die Kreuzzüge mit ihrer am Ende vergeblichen Eroberungspolitik dienten gleichermaßen dazu, den byzantinischen Besitz und nunmehr vom Islam okkupiertes ehemals römisches Herrschaftsgebiet zurückzugewinnen. Auch dies war Teil der Renovationsidee: dass das römische Reich gleichermaßen Herrschaftsgebiet des Christentums und damit das irdische Reich Jesu Christi sei.
Diese mehr als verschwommene, aus Geschichtserinnerung, Glaubenseifer und Machtegoismus gespeiste Idee hatte zwischen dem 10. und dem 13. Jh. ihre realpolitischen Konsequenzen. Sie bestimmte die Italienansprüche und Italienfeldzüge der ostfränkisch-deutschen Herrscher bis hin zum letzten Stauferkönig Friedrich II., der, auch aus solchen Gründen, das Regierungszentrum seines Reiches im südlichen Italien behielt. Sie endete mit dem letzten Kreuzzug. Zwar blieb der Kaisertitel weiterhin an Herrscher rechts des Rheines gebunden, doch die Machtansprüche, die ihm im frühen Hochmittelalter anhafteten, gingen dahin. Das Amt wurde mehr und mehr zur leeren Behauptung, gegen die sich bloß vereinzelt die Inhaber auf- lehnten, mit wechselndem Erfolg; allein das hohe gesellschaftliche Prestige blieb ihm erhalten.
Die ideale Konstruktion der feudalistischen Herrschaftspyramide mit dem Monarchen an der Spitze, der, gestützt auf den belehnten Hochadel, seine Geschäfte wahrnahm, wobei er bestimmte Zuständigkeiten an die unteren Schichten delegierte, wurde von der Realität nirgends vollkommen eingelöst. Der Idee des Lehens stand die durch Gewohnheitsrecht unterfütterte Praxis des Dauereigentums entgegen. Eroberungskriege schufen neue Zustände, alte Ansprüche standen gegen jüngere, Rechtsvorstellungen widersprachen einander.
Solchen Filz aus unklaren Verhältnissen zu beseitigen, bedurfte es eines entschlossenen Willens und einer starken Hand. Manchmal gab es sie; mit einer Politik der pragmatischen Grausamkeit und Härte gelangte sie zu durchaus achtbaren Resultaten. Die Herrschaft König Heinrichs II. aus dem Hause Plantagenet ist ein Beispiel. Er nahm die durch Wilhelm den Eroberer geschaffenen Vorgaben entschlossen auf und verwandelte England in eine straff geführte, mit einer effizienten Verwaltung ausgestattete Monarchie. Ähnliche Figuren waren König Ludwig IX. von Frankreich und König Kasimir der Große von Polen.
Ihnen gemeinsam ist auch, dass ihre Leistung zwar ihren Tod überdauerte, den späteren Zerfall und Niedergang, die mit fast naturgesetzlicher Gewissheit geschahen, aber nicht verhindern konnte. Unruhen, Revolten und Kriege waren die Folge. Dabei konnte das ursprüngliche Herrschaftsterritorium beschnitten oder atomisiert werden, manchmal mit bleibenden Folgen. Das alles skandinavische Nordeuropa umfassende Reich der Königin Margarete von Danemark zerfiel wieder, die einzelnen Länder beanspruchten und erlangten ihre staatliche Autonomie.
Dänemark, wiewohl heute als ein Kleinstaat, existiert noch. Andere Reiche verschwanden gänzlich wie das im Spätmittelalter noch mächtige und glanzvolle Burgund. Die Ursachen für solche Dekadenz sind von Fall zu Fall verschieden, doch haben sie fast immer mit einer Schwächung der Zentralgewalt zu tun.
Königsherrschaft war entweder unter das Prinzip der Adelsdemokratie oder das der Erbfolge gestellt. Beide hatten ihre Tücken. Die feststehende Erbfolge, gewöhnlich verbunden mit dem Prinzip der männlichen Primogenitur, riskierte es, dass ein schwacher, ungeeigneter Anwärter die Herrschaft übernahm. Die Wahlmonarchie riskierte es, dass die kürenden Magnaten sich auf jenen Anwärter einigten, der ihre partikularen Interessen am wenigsten bedrohte und also politisch besonders schwach war. Alles in allem erwies sich die dynastische Erbfolge als erfolgreicher. Wie verheerend die intellektuellen und charakterlichen Vorgaben des Erben immer sein mochten, wenigstens bestand hier die Chance, diesen auf sein künftiges Amt einzuüben, wobei auch die vom Vorgänger benutzte Administration strukturell wie personell erst einmal erhalten blieb.
Dabei ist die Wahlmonarchie, jedenfalls für Westeuropa, das ältere Verfahren. Die germanischen Stämme, zu denen die siegreichen Franken gehörten, kürten aus ihrer Mitte einen besonders geeigneten Führer. Das Erbfolgeprinzip hat sich erst während des folgenden Mittelalters etabliert, wobei Elemente der Wahlpraxis erhalten blieben. Im ostfränkisch-deutschen Raum ging der förmlichen Einsetzung eines neuen Königs eine Adelsversammlung voraus, die den König berief und ihm in bestimmten Riten zu huldigen hatte; danach erhielt er die Insignien und wurde gesalbt, erhielt also den göttlichen Segen, und war damit inthronisiert. Die deutschen Herrscher versuchten die Erbfolge dadurch zu etablieren, dass sie ihren Nachfolger noch zu Lebzeiten designierten und durch die Adelsversammlung bestätigen ließen; wenn er dann sein Amt antrat, mussten freilich Wahl und Huldigung wiederholt werden. Es hat die Existenz von Gegenkönigen und blutige Auseinandersetzungen › nicht verhindern können. Die durch Kurfürsten exekutierte Wahlmonarchie blieb den Deutschen bei der Kaiserherrschaft erhalten, die zunehmende Schwächung dieses Amtes hatte auch damit zu tun.
In England und Frankreich verliefen die Dinge anders. Zwar gab es auch hier immer wieder die Schwächung der monarchischen Macht, durch konkurrierende Ansprüche, durch innere Konflikte, durch Kriege nach außen, was bis zur existenziellen Bedrohung führen konnte, in Frankreich etwa mit dem Hundertjährigen Krieg, in England mit den Rosenkriegen zwischen York und Lancaster aus dem Haus Plantagenet, doch beide Länder konnten sich davon erholen. Mit Jeanne d'Arc begann die Regeneration des französischen Königtums, Während in England durch die Rosenkriege der partikularistisch gesinnte Hochadel vernichtet wurde und dem Aufstieg der Tudorherrschaft damit nichts mehr im Wege stand. Der geschichtliche Erfolg Englands wie Frankreichs hatte auch damit zu tun, dass in beiden Ländern von früh an eine feste geopolitische Mitte bestand, in Frankreich Paris, in England London. Deutschland kannte dies lange Zeit nicht. Die deutsche Königsherrschaft wurde im Pferdesattel vollzogen.
Gleich nach seiner Krönung begab sich der neue Herrscher auf seinen Königsumritt. Er sollte ihn in alle von ihm regierten Landschaften führen und ihm dort die allgemeine Zustimmung bescheren. Er wurde auch hinfort nie mehr etwas anderes tun. Er reiste dabei nicht auf festgelegten Routen, sondern er begab sich mal hierhin, mal dorthin, seine Motive waren Pflicht oder Neigung, und entscheidend war auch, dass am Ende der jeweiligen Route eine Unterkunft für sein vielhundertköpfiges Gefolge bereit stand. Überall im Land besaß er dafür königliche Pfalzen sowie kirchliche Residenzen in Bischofsstädten, wo er einkehren und den Regierungsgeschäften nachgehen konnte, wo er Synoden abhielt und Gesandte empfing. Die unfeste Existenz des deutschen Königs bot den beträchtlichen Vorteil der ständig wechselnden Gegenwärtigkeit und den Nachteil, dass überall dort, wo der Herrscher sich gerade nicht aufhielt, die Zustände dazu neigten, der zentralen Kontrolle zu entgleiten. Das zweite wog stärker. Die Schwächung der deutschen Königsmacht hat unter anderem mit dieser Reiseherrschaft zu tun.
Die Erbfolge schuf eine Reihe von Herrscherdynastien, die für ihre Länder teilweise sehr prägend wurden. Von den Plantagenets in England war bereits die Rede. Sie bestimmten die Geschicke des Landes mehr als vierhundert Jahre. Frankreich wurde die erste Hälfte des Mittelalters von den Kapetingern, die zweite von den Valois regiert, Polen von den Piasten und Jagiellonen. In Deutschland hießen die Geschlechter Ottonen, Salier, Staufer, und erst mit den Habsburgern stellte sich endlich eine bis in die Neuzeit hinein regierende Dynastie ein.